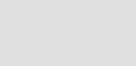„Früher war alles besser.“ Ein Satz, dem ich normalerweise zutiefst misstraue. Mit einer Ausnahme: Früher war es möglich, auf den damals noch unverbauten Hängen in unmittelbarer Stadtnähe Ski zu fahren oder zu rodeln. Betätigungen, die entscheidend zum rasanten Aufstieg Innsbrucks zur Sportstadt beigetragen haben.
Das winterliche Innsbruck ist einzigartig. Kein Wunder, dass das Skifahren zum Volkssport geworden ist. Foto: Innsbruck Tourismus/Tom Bause
Es war dann die Blütezeit des Skisports in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, die Innsbruck in die Rangliste der Top-Wintersportdestinationen katapultierte. Skifahren war damals hierzulande nicht nur die mit Abstand populärste Sportart: Die Hälfte der Einwohner waren Skifahrer. Kein Wunder auch, dass bis heute 16 Weltmeister und 13 Olympiamedaillengewinner aus dem Großraum Innsbruck stammen. Der Medaillenspiegel ist noch beeindruckender: Innsbrucker Wintersportler gewannen insgesamt 68 Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Zwei Olympiaden festigten dann unseren Ruf als Hauptstadt des Skisports endgültig.
Die Erfolgsgeschichte Innsbrucks als Sportstadt beginnt mit einer simplen Tatsache: Skifahren konnte man früher in Innsbruck meist bis ‚vor die Haustüre‘. Ob die kühnen Skifahrer mit ihren bis zu zwei Meter langen Brettern von der Mutterer Alm, dem Patscherkofel oder der Nordkette zu Tal schwangen – die hurtige Fahrt endete bei guter Schneelage in der Stadt. Die logische Folge: In einer Zeit, die kaum Autos kannte, lagen die Trainingsbedingungen quasi vor der Haustüre und waren jahrzehntelang ein immenser Vorteil bei großen, internationalen Skirennen. Wie etwa dem 1933 abgehaltenen FIS-Rennen in Innsbruck, das gleichzeitig die 3. Alpinen Skiweltmeisterschaften darstellte. Eine profunde Darstellung der FIS-Rennen vermittelt die Website des Stadtarchivs Innsbruck genauso wie nostalgische Erinnerungen an die einstigen Skihügel.
Das FIS-Rennen des Jahres 1933 machte Innsbruck weltbekannt. Das Rennen galt auch als 3. Alpine Weltmeisterschaft. Ähnlich bekannt ist das Titelbild des Programmheftes für die FIS-Wettkämpfe. Bild: Stadtarchiv Innsbruck
Auch im Sport fallen Meister weder vom Himmel noch werden sie als solche geboren. Trainingsmöglichkeiten sind von großer Bedeutung. Die Lernbehelfe waren Ski oder Rodel, die Übungsplätze jene Hänge, die schon damals als ‚Übungshügel‘ bezeichnet wurden. Unverbaute Hänge am Stadtrand waren für Kinder und Jugendliche im Winter Spiel- und Sportplatz zugleich.
Bei guter Schneelage herrschte auf allen unverbauten Hängen in Stadtnähe reger Betrieb. Zuerst wurde dort gerodelt, später vor allem Ski gefahren. Bild: Stadtarchiv Innsbruck
Das Skifahren selbst wurde allerdings nicht in Innsbruck erfunden. Es waren die Norweger, die den Umgang mit Schneeschuhen und ‚Gleithölzern‘ schon lange beherrschten. Und dann waren da noch die englischen Studenten, die aus der Lebensrealität der Norweger Sportarten formten. Schlitten bauten sie zu Bobs um, sie kurvten am Eis herum und rasten bäuchlings auf Kufen mit ihren Skeletons zu Tal. Und jetzt wurden die winterlichen Fun-Sportarten noch um das Skifahren erweitert.
Die norwegische Skitechnik eignete sich anfänglich nicht unbedingt für die steileren Hänge der Alpen. Also mussten neue Fahrtechniken erfunden werden. Im Vordergrund dieses Fotos sind sogar noch Spuren von Schneeschuhen zu sehen. Bild: Stadtarchiv Innsbruck
„Bei Gefahr zu Boden werfen“
Dabei hatte es bei ersten Erprobungen der neuartigen ‚Gleitbretter‘ in Tirol gar nicht danach ausgesehen, als dass sie sich im Winter als Sportgerät durchsetzen sollten. Nachdem um 1890 die ersten Ski nach Innsbruck gelangten, stellte ihnen Julius Pock 1892 ein nicht wirklich gutes Zeugnis aus. Seine Erfahrungen nach einem Test auf der Waldrast fasste er so zusammen:
„Auf ebenen oder nur sanft geneigten Schneefeldern leisten die ‚Ski‘ treffliche Dienste … Dagegen ist das Abfahren über stark geneigte Hänge, z.B. von 20° – 35° Neigung und gefrorenen Schnee nicht harmlos; einmal in Bewegung, geht es mit ungeheurer Schnelligkeit dahin, Bremsen mit dem Stocke bleibt völlig wirkungslos. Droht Gefahr, an ein Hindernis geschleudert zu werden, so kann man nur dadurch, daß man sich zu Boden wirft, der rasenden Fahrt Einhalt thun.“
Kein Wunder, dass Rodeln damals wesentlich beliebter war als das Fahren mit den Ski.
Die Zweistocktechnik setzte sich bei uns schon bald durch und machte das Skifahren zur beliebtesten Sportart der Innsbrucker. Bild: Stadtarchiv Innsbruck
Rodeln gehörte lange Zeit zu den beliebtesten Wintersportarten in Innsbruck. Kein Wunder, wurden doch bei guten Schneeverhältnissen alle Wege und Straßen zu Rodelbahnen umfunktioniert. Bild: Stadtarchiv Innsbruck
Eine andere Episode aus den Anfangstagen des Skisports in Tirol berichtet davon, dass Alfons Siber, ein Skipionier aus Hall, auf einer Geländekante abgesprungen und einige Meter danach wieder im Schnee gelandet war. Bauern sahen die unterbrochenen Spuren und waren überzeugt: „Dös kann nur der Tuifl sein, denn der ist a durch die Luft g’flog’n“.
Ob sich Skispringer als Teufel gefühlt hatten, ist unbekannt. Tatsache ist aber, dass das Skispringen geraume Zeit beliebter war als das Skifahren. Schanzen wuchsen quasi aus dem Boden: am Bergisel und auf der Seegrube.
Das Skispringen war auch in Innsbruck lange vor dem alpinen Skifahren beliebt. Hier ein Bild von einem Skispringen auf der Seegrube. Bild: Stadtarchiv Innsbruck
Die legendäre Ferrariwiese
Mit ein Grund, weshalb Innsbruck zu einem Skizentrum aufsteigen konnte, waren also die Übungsbedingungen. Da konnten auch erste Talentsichtungen gemacht werden. Eine bedeutende Rolle als Übungsplatz nahm die Ferrariwiese ein.
Und sie könnte heute noch ein solcher sein, hätte man vor rund zehn Jahren auch nur ein einziges Foto gefunden, auf dem Skifahrer abgebildet sind, die innerhalb der letzten 30 Jahre dort gefahren waren. Es war die Zeit, als man Deponieplätze für den Abraum des Brenner Basistunnels suchte. Wäre der fotografische Beweis gelungen, der Skifahrer innerhalb der vorausgegangenen 30 Jahre auf der Ferrariwiese zeigt, wäre die Wiese quasi als Skiwiese ersessen gewesen. Eine Umwidmung zur Schuttdeponie des Brenner Basisunnels wäre damit verhindert worden.
Ein historisches Bild der Ferrariwiese vor der monumentalen Nordkette. Das Negativ, in dem auch die Beschriftung für den Ansichtskartendruck zu sehen ist, stammt aus den Beständen Much Heiss/Alpiner Kunstverlag/Foto Margit. Die Glasplatte hat stark gelitten, und doch erfreut uns eine friedliche Szene wie aus einem Wimmelbild-Kinderbuch. Ganz ohne falsche Nostalgie: Wie fantastisch war dieses Panorama ohne die Südtangente der Autobahn? Bild: Stadtarchiv Innsbruck
Die Mutterer Alm war ein weiteres Übungszentrum, das in den früher meist schneereichen Wintern sogar mit der Stubaitalbahn erreichbar war. Beste Voraussetzungen für den Skiklub Innsbruck, eine intensive Nachwuchsarbeit zu pflegen.
Als Autos noch selten waren, fuhr man mit der Stubaitalbahn auf die Mutterer Alm. Bild: Stadtarchiv Innsbruck
Nach dem Bau der Nordkettenbahn wurde die Seegrube zu einem Übungsgebiet der Extraklasse. Und wenn’s da oben einmal zu neblig oder zu gefährlich war, fanden die Kinderskikurse auf der Wiese hinter dem Parkplatz der Nordkettenbahn statt.
Lesetipps:
Die Website des Stadtarchivs Innsbruck ist eine wahre Fundgrube für Geschichten aus der Frühzeit des Skisports. Sie ist ein jederzeit öffentlich zugängliches ‚Gedächtnis‘ unserer Stadt. Ich bedanke mich für die Genehmigung zur Verwendung der Fotos in diesem Beitrag.
Anneliese Gidl, Lukas Morscher und Gertraud Zeindl: Sport in Innsbruck bis 1960.
Bewerte den Artikel
Zeige mir den Ort auf der Karte
Alm-Freiwilliger in der 'Schule der Alm', Kultur-Pilger, tirol-Afficionado, Innsbruck-Fan.
Ähnliche Artikel
„Wenn die Biene von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine…
Als ich Isobel Cope das erste Mal traf, war ich gerade dabei, meine Radiosendung Sensations in the…
Klick. So eine Datenschutzerklärung ist ratzfatz akzeptiert. Klick. Und schon weiß der Computer Bescheid: Über dich, über…
Die gebürtige Peruanerin Sandra Chamochumbi Castro ist Mitglied der von Enrique Gasa Valga neu gegründeten…